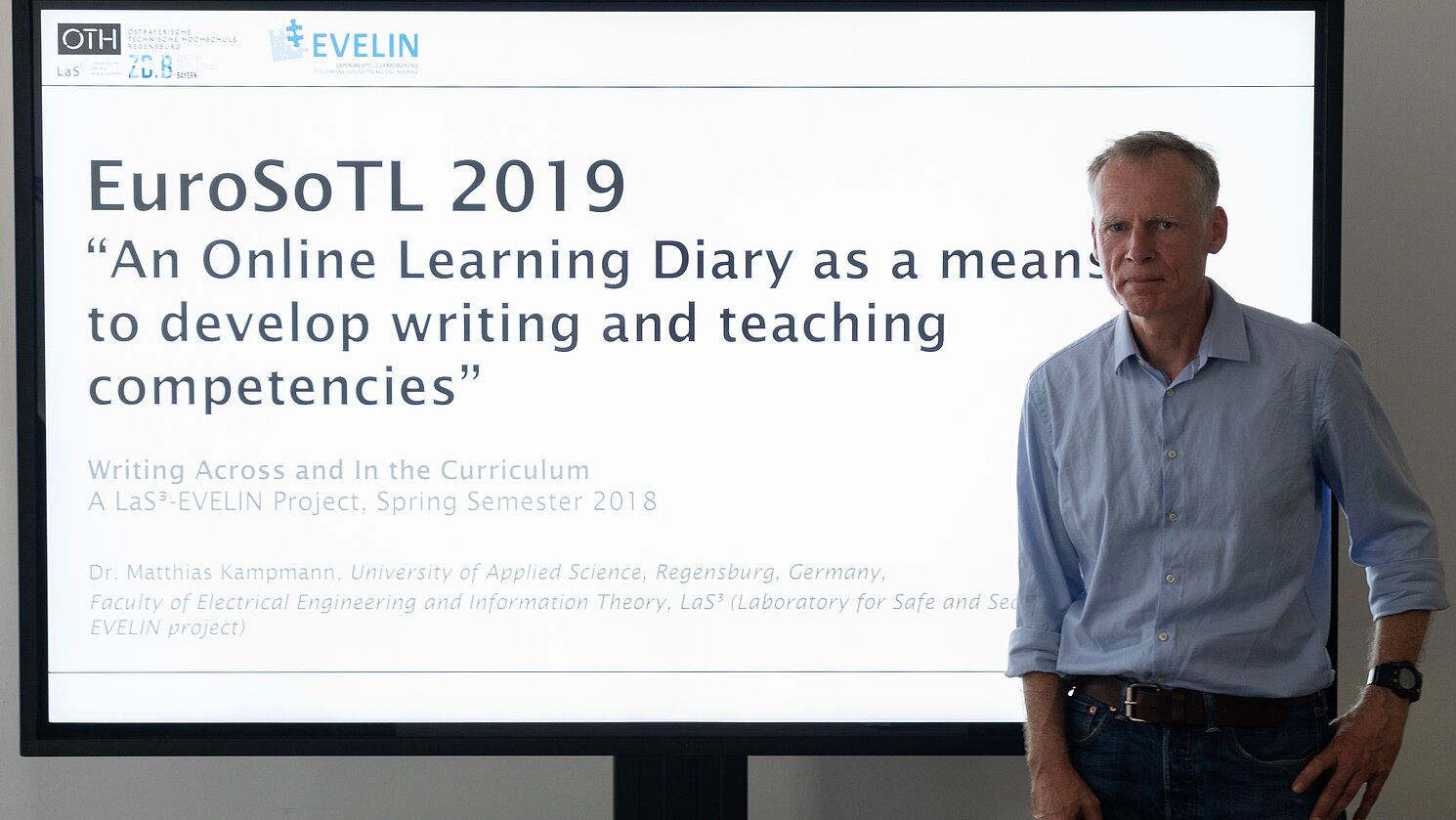„Lehrende können die besten didaktischen Methoden einsetzen und dennoch bei der nächsten Leistungsabfrage feststellen, dass der Output nicht den erhofften Sprung zu besseren Noten geliefert hat“, erläutert Dr. Matthias Kampmann. Dr. Kampmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Verbundprojekt EVELIN im Software Engineering Laboratory for Safe and Secure Systems (LaS3), das von Prof. Dr. Jürgen Mottok an der Fakultät Elektro- und Informationstechnik der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) geleitet wird.
Um den Grad an Wirksamkeit herauszufinden, müsse man sich und seine Lehre unter anderem mit empirischen Methoden beobachten. Das sei das Prinzip des „Scholarship of Teaching and Learning“ (SoTL). Alle zwei Jahre trifft sich die europäische Sektion von SoTL. Im Juni 2019 fand im baskischen Bilbao die EuroSoTL19 statt. Dr. Kampmann präsentierte dort die Ergebnisse der Selbstbeobachtung einer vorlesungsbegleitenden Übung der Fakultät Elektro- und Informationstechnik.
Schreibkompetenz als Bedingung erfolgreicher Arbeit
Im Sommersemester 2018 begleiteten regelmäßige Schreibübungen die Vorlesung „Software Engineering sicherer Systeme“. Im Rahmen von EVELIN versuchte Dr. Kampmann zusammen mit Florian Hauser, Sabrina Jahn und Rebecca Reuter, Antworten auf die Forschungsfrage zu geben: „Führen regelmäßige Schreibanlässe zu besseren Schreib-, Inhalts- und Reflexionskompetenzen der Software-Engineering-Studierenden?“
Software Engineering ist eine anspruchsvolle Wissenschaft. Und Schreibkompetenz ist eine Bedingung für erfolgreiche Arbeit. Studierende verlieren allerdings aufgrund mangelnder Anlässe im Studium die Befähigung zu korrektem und präzisem Schreiben. „Dabei ist Schreiben lernbar. Es ist noch kein Gen gefunden worden, das bestimmt, wie gut oder schlecht jemand schreibt. Dagegen gibt es Studien, die belegen, dass man Schreibkompetenz verliert, wenn nicht geschrieben wird“, beschreibt Dr. Matthias Kampmann.
Das Projekt „Online-Lerntagebuch“
Das Projekt mit der Bezeichnung „Online-Lerntagebuch“ (OLTB) basierte auf den Erfahrungen mehrerer Semester. Im Sommer 2018 gaben ihm die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine feste Struktur und praktizierten sie über die Moodle-Lernplattform. Neben fachlichen Fragen, die in ganzen Absätzen beantwortet werden sollten, stellte der Pädagoge Florian Hauser Woche für Woche reflektorische Fragen.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lasen und kommentierten daraufhin die Texte der 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus fachlicher, pädagogischer und sprachlicher Perspektive. Die Arbeiten wurden nach transparenten Rubrics bepunktet. Korrekturen und Ergänzungen wurden ebenso offen über Änderungs- und Kommentarfunktionen in der Textverarbeitungssoftware als praktische Unterstützung verdeutlicht. Schreibregeln etwa ließen sich auf diese Weise weitgehend ohne linguistische oder grammatische Fachtermini vermitteln.
Im Sinne von SoTL protokollierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit für die spätere Auswertung. Die Beobachtung begleitete ein obligates Beratungsgespräch und die Ausgabe eines validierten Fragebogens zu Beginn und am Ende des Semesters. Insgesamt schrieben die Studierenden knapp über 75.000 Wörter. Das entspricht einem Buch mit zirka 110 Standardseiten.
Ergebnis: regelmäßiges Schreiben hilft
Nach dem Semester las Dr. Kampmann noch einmal sämtliche Artefakte und zählte in sechs Fehlerkategorien sämtliche sowohl grammatische als auch Mängel in Rechtschreibung und Zeichensetzung. Ergebnis: Die Anzahl der Fehler pro OLTB im Lauf des Semesters nahm leicht ab. Damit bestätigte sich im Ansatz die These, dass regelmäßiges Schreiben diese Kernkompetenz stärke.
Eine statistische Analyse brachte allerdings auch ans Tageslicht, dass es unterschiedliche Bewertungshaltungen in den drei Kategorien Inhalt, Sprache, Reflexion gab. Außerdem wurde festgestellt, dass über das Semester selbst einfache Regeln wie die Kommasetzung bei Infinitivgruppen nicht nachhaltig internalisiert werden konnten. Das führte zur Frage, die auch in Bilbao diskutiert wurde: War die Konzentration des Angebots auf korrektes Schreiben der richtige Weg? Das OLTB, so das Ergebnis, ist nicht die perfekte Sprachbegleitung. Die Selbstbeobachtung nahm direkten Einfluss auf die Schreibarbeit in den beiden folgenden Semestern und führte zu anderen Formaten.
Die Konferenz, an der knapp 370 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 24 Ländern und von 104 privaten wie öffentlichen Hochschulen und Universitäten teilnahmen, bot beispielsweise Antworten auf Fragen nach Ursachen für sinkende Teilnehmerzahlen während des Semesters. Die Berichte von Best Practices belegten, dass Kontakte über Lernplattformen allein nicht hinreichend sind. Reale Präsenz und ein Bewusstsein für die realen Räume, in denen die Lernveranstaltungen stattfinden, prägen das Lernverhalten, belegen die Untersuchungen.
Auch menschliche Aspekte im Blick
Keynote-Sprecher Peter Felten, Elon University, USA, stellte überdies die Beziehung unter Studierenden und zwischen Studierenden und Lehrenden ins Zentrum seiner Ausführungen. Dabei sensibilisierte er für scheinbar offensichtliche Selbstverständlichkeiten, etwa die Ansprache per Namen oder den Klang der Stimme. SoTL basiert also nicht nur auf der Anwendung empirischer Methoden, sondern nimmt auch humanistische Faktoren in den Blick.
„Diese Konferenz war sehr fruchtbar. Sie bestätigte, dass man sich nicht auf die Intuition verlassen, sondern genau auf seine didaktische Arbeit schauen und außerdem auf kulturelle Werte und wertebewusstes Handeln achten sollte“, zieht Dr. Kampmann als Fazit.
Über das Forschungsprojekt EVELIN
Die Lehr- und Lernforschung Software Engineering am LaS3 der Fakultät Elektro- und Informationstechnik der OTH Regensburg ist gefördert durch das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzierte Verbundvorhaben "Experimentelle Verbesserung des Lernens von Software Engineering (EVELIN)", Förderkennzeichen 01PL17022F, Projektträger DLR. Das Verbundvorhaben EVELIN ist im Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre angesiedelt. Die Hochschulen Aschaffenburg, Coburg, Kempten, Neu-Ulm und Regensburg sind Verbundpartner.
Weitere Informationen zum Forschungsprojekt EVELIN sind auf der Website des LaS3 und auf den Seiten von Qualitätspakt Lehre nachzulesen.
Software Engineering Laboratory for Safe and Secure Systems (LaS3)
Das Software Engineering Laboratory for Safe and Secure Systems (LaS3) ist ein gemeinsames Kompetenzzentrum der "Ostbayerischen Technischen Hochschule": ein Verbund zwischen den Ostbayerischen Technischen Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg. Prof. Dr. Jürgen Mottok zeichnet als wissenschaftlicher Leiter verantwortlich. Das LaS3 wurde 2005 gegründet und wurde initial durch die Projektförderung „FHprofUnt“ der Bundesrepublik Deutschland sowie durch das Programm „Strukturimpuls“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst unterstützt.
LaS3 sieht sich als Mediator zwischen Wissenschaft und Anwendung: Ziel ist die Verzahnung von anwendungsorientierter Forschung im Bereich der Softwareentwicklung mit den Anforderungen sowohl mittelständischer Unternehmen als auch der Industrie im ostbayerischen Wirtschaftsraum.